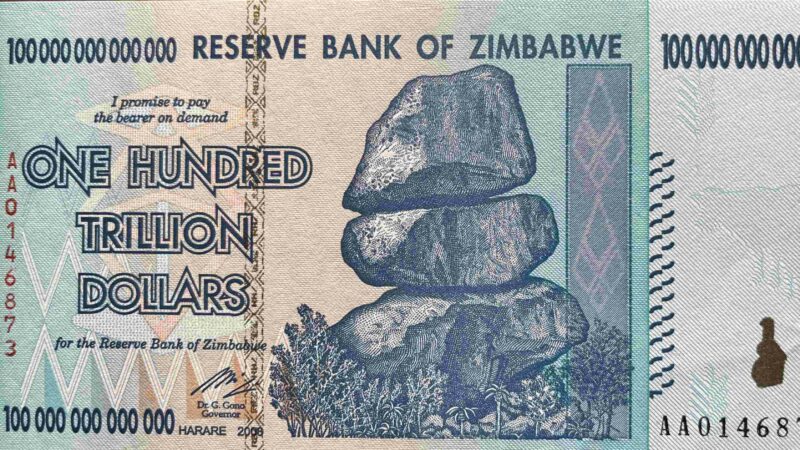Die Familie ist das erste Unternehmen
Die Familie ist das erste Unternehmen Überbordender Sozialstaat, exorbitante Steuerbelastung und stetig zunehmende öffentliche Verschuldung sind Symptome dafür, in welch hohem Maße der moderne Bürger vom Staat und seinen Bürokratien und damit auch von der Politik in Abhängigkeit geraten ist. Individuelle Freiheit und Eigenverantwortung sind dabei zunehmend unter die Räder geraten. Die Familie, gegründet auf der Ehe zwischen Mann und Frau, gilt immer weniger als gestaltende Grundlage der menschlichen Gesellschaft. Sie wird oft als „Auslaufmodell“ verunglimpft oder im besten Fall als mögliche „Option“ unter vielen trivialisiert. Sie ist zunehmend zum Objekt staatlicher Überlebenshilfen geworden, die aus Mitteln gespeist werden, die der Staat den Empfängern dieser Hilfen zuvor in der Form von Steuern weggenommen hat.
Auf der anderen Seite werden von Politikern und oft auch von Kirchenleuten unter dem Beifall der Öffentlichkeit die „Reichen“, Unternehmer und „Kapitalisten“ als Parasiten verteufelt und für die Auswüchse der Politik zur Kasse gebeten – genau jene also, die ihren Reichtum nicht nur für den privaten Konsum, sondern vor allem für die Erzeugung neuen Reichtums zur Verfügung stellen, was durch die Schaffung von Arbeitsplätzen und die Ermöglichung neuer und innovativer Technologien allen zugutekommt.
Ein sozialphilosophisches Prinzip
Die zunehmende Korrosion der Familie durch ihre sozialstaatliche Relegation in die weitgehende Funktionslosigkeit und gleichzeitige finanzielle Überlastung sowie die bürokratische Behinderung des wertschöpfenden Unternehmertums durch staatliche Bevormundung und Interventionen in den freien Markt sind Folge der Missachtung eines fundamentalen Prinzips: des Subsidiaritätsprinzips. Fachleute kennen den Terminus vornehmlich aus dem EU-Recht. Wenige wissen, dass das im Maastrichter Vertrag ausgesprochene Prinzip der Subsidiarität zumindest seinem Namen nach auf die katholische Soziallehre zurückgeht. Es wurde 1931 von Papst Pius XI. zum ersten Mal formuliert.
Gemäß Artikel 5 des Maastrichter Vertrags, mit dem die Europäische Union geschaffen wurde, bedeutet das Subsidiaritätsprinzip, dass „die Union in den Bereichen, die nicht in ihre ausschließliche Zuständigkeit fallen, nur tätig“ wird, „sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind.“ Das Prinzip ist letztlich ein Prinzip der Effizienz. In der EU-Version eignet ihm die Tendenz zu immer größerer Zentralisierung, vorausgesetzt die Zentralgewalt kann nachweisen, dass sie dies oder jenes besser und effizienter als die untere Ebene machen kann. Solche Zentralisierung liegt in der Logik der erwünschten zunehmenden „Integration“ die ja durch das ebenfalls geltende Solidaritätsprinzip vorangetrieben werden soll.
Der ursprüngliche Sinn des Subsidiaritätsprinzips, wie es der katholischen Soziallehre entspringt, war jedoch ein anderer. Es bezweckt nicht unmittelbar größtmögliche Effizienz, sondern Respektierung, ja Förderung individueller Freiheit und kleinräumiger Verantwortlichkeit. Es ist ein sozialphilosophisches Prinzip, das ein bestimmtes Bild des Menschen voraussetzt, also anthropologische Wurzeln besitzt. Diese Wurzeln bestehen in der Sicht des Menschen als eigenverantwortliches Individuum, das im Bezug mit anderen Menschen lebt, auf diese angewiesen ist und durch die Interaktion mit ihnen auf vorteilhafte Weisen die Beschränkungen seiner Natur überwinden und seine Bedürfnisse decken kann. Der Mensch erscheint so als freies und zugleich gesellschaftliches Wesen, das von Anfang seines Lebens an in natürlich gegebenen sozialen Bezügen existiert.
Deshalb – und hier wird das Prinzip normativ – sollen die gesellschaftlichen Akteure vornehmlich die einzelnen Menschen sein: einerseits in der Familie, die die menschliche Gesellschaft reproduziert und zukünftigen Bürgern die Grundlagen von Bildung und Sozialkompetenz verleiht; andrerseits auf dem freien Markt, auf dem Menschen in wechselseitig vorteilhafter Weise miteinander in Tauschbeziehungen treten und damit neuen Reichtum schaffen und ein Anheben des allgemeinen Wohlstandsniveaus bewirken. In der Marktwirtschaft – wobei man den Begriff „Markt“ nicht durch die Beschränkung auf materielle Werte verengen sollte – nützt das Verfolgen der eigenen Zwecke immer auch den anderen, die ihrigen zu erreichen. Die Logik des Marktes entspricht deshalb in besonderer Weise der sozialen Natur des Menschen. Sie macht das Zusammenleben der Menschen zu einem wechselseitig vorteilhaften Geschehen.
Der freie Markt ist der Nährboden für schöpferisches und innovatives Unternehmertum, das wie auch die Familie auf dem Privateigentum beruht und genau dadurch sozial segensreiche Auswirkungen zeitigt. Doch besitzt ihrer Natur nach auch die Familie – die auf der Natur gründende menschliche Reproduktions- und Vorsorgegemeinschaft – einen unternehmerischen Charakter, der ihr aber durch den für- und vorsorgenden Sozialstaat weitgehend abhanden gekommen ist – mit gravierenden Folgen. Die Verantwortung der meisten Familien besteht heute immer mehr nur noch darin, den täglichen Konsum, die Freizeit und die Ferien zu planen.
„Sozialverpflichtung des Privateigentums“ und Kapitalismus
Gemäß traditioneller christlicher Lehre ist das Recht auf Privateigentum kein absolutes Recht, sondern es steht im Dienst des Prinzips, dass die Güter dieser Erde für alle Menschen bestimmt sind (dies vertrat auch der klassische Liberalismus in der Tradition von John Locke). Die katholische Kirche lehrt – am ausführlichsten in der ersten Sozialenzyklika „Rerum novarum“ von Papst Leo XIII. und wiederum in Übereinstimmung mit dem klassischen Liberalismus –, dass dies gerade durch das Privateigentum am besten erreicht wird und der Staat es deshalb zu schützen hat.
Die auf dem Privateigentum lastende Sozialverpflichtung ist kein Freipass für den Staat, es durch Besteuerung mit dem Ziel der Umverteilung teilweise zu konfiszieren (aus Steuergeldern finanzierte Infrastrukturen beruhen hingegen nicht notwendigerweise auf Umverteilung und heben den allgemeinen Wohlstand). Die Sozialverpflichtung des Privateigentums ist eine moralische Verpflichtung des Eigentümers, sein Eigentum nicht nur für den eigenen Konsum zu verwenden, sondern auch auf die Bedürfnisse des Mitmenschen zu achten, vor allem wenn dieser sich in extremer Not befindet. In vorkapitalistischen und vorindustriellen Gesellschaften geschah dies vornehmlich durch Almosen und andere Werke der Nächstenliebe. Heute geschieht es effizienter und mit noch nie dagewesenen Wohlstandsfolgen durch das Investieren von Reichtum, wodurch dieses zu Kapital wird, das Arbeitsplätze schafft, die wiederum zum Ausbezahlen von Löhnen führen.
Der Kapitalismus ist ja, mit den Worten von George Gilder, die „Wirtschaftsform des Gebens“, in der man nur dadurch reicher werden kann, indem man auch andere bereichert. So wie Henry Ford, der steinreich starb, zuvor durch die Schaffung eines für alle erschwinglichen Automobils das Leben seiner Mitbürger, ja eines ganzen Landes verändert hatte (auch indem er tausenden von Arbeitern einen festen Lebensunterhalt ermöglichte und zudem in seinen Fabriken als erster den Achtstundentag einführte, zwei Jahrzehnte bevor eine solche Arbeitszeitregelung in den USA gesetzlich festgelegt wurde).
Individuelle Freiheit, Familie, Marktbeziehung und Unternehmertum: Sie allein genügen jedoch nicht. Menschen schließen sich notgedrungen, zum Überleben und zum besseren Leben zu „höheren“ Sozialgebilden zusammen und schaffen sich entsprechende Organe, genannt Regierungen. Dies zu dem Zweck, dadurch ihre Ziele besser erreichen zu können, insbesondere den Schutz von Leben und Eigentum. Aber der Staat ist weder Ziel der Existenz noch Hauptakteur. Er steht im Dienste des Individuums, der Familie und der Ermöglichung freier und wechselseitig vorteilhafter Markttransaktionen. Durch interventionistische Wirtschafts- und Sozialpolitik wird der Staat langfristig zum Wohlstandsvernichter, zum bürokratischen Großkonsumenten, der immer mehr Menschen in seinem Dienst Löhne für eine Arbeit ausbezahlt, die die unternehmerische Produktivität behindert, selbst aber weitgehend unproduktiv ist. Dazu fördert er das weitverbreitete Übel, das die Amerikaner „Crony Capitalism“ nennen: Die Allianz von Big Business und Big Government, die Verfilzung von Staat und Großunternehmen – „Klientelismus“ –, die ökonomisch ineffizient, diskriminierend und moralisch fragwürdig ist, auch dann, wenn sie so hehren Zielen wie dem Umweltschutz dient.
Subsidiarität und menschliche Natur
Die „Effizienz“ echter Subsidiarität ist letztlich eine Folge der Respektierung der menschlichen Natur: Der Mensch ist ein freies und eigenverantwortliches Wesen und diese Eigenschaften verwirklichen sich nur dort, wo der Mensch für die Folgen seines eigenen Handelns selbst die Verantwortung zu tragen vermag. Das schafft die richtigen, auch die moralisch richtigen Anreize und ist genau deshalb „effizient“. Ökonomen sprechen hier vom Zusammenhang von Risiko und Haftung. Das Subsidiaritätsprinzip ist deshalb ein Prinzip, das Handeln in überschaubaren Zusammenhängen fordert. Es widerstrebt allen Formen von Zentralismus und bewirkt, dass jene entscheiden, die auch von den Folgen ihrer Entscheidungen direkt betroffen sind.
So formulierte denn Papst Pius XI. 1931 in seiner Enzyklika „Quadragesimo anno“ auf folgende Weise den, wie er schrieb, „höchst gewichtigen sozialphilosophischen Grundsatz“, der später „Subsidiaritätsprinzip“ genannt wurde: „Wie dasjenige, was der Einzelmensch aus eigener Initiative und mit seinen eigenen Kräften leisten kann, ihm nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen werden darf, so verstößt es gegen die Gerechtigkeit, das, was die kleineren und untergeordneten Gemeinwesen leisten und zum guten Ende führen können, für die weitere und übergeordnete Gemeinschaft in Anspruch zu nehmen; zugleich ist es überaus nachteilig und verwirrt die ganze Gesellschaftsordnung. Jedwede Gesellschaftstätigkeit ist ja ihrem Wesen und Begriff nach subsidiär; sie soll die Glieder des Sozialkörpers unterstützen, darf sie aber niemals zerschlagen oder aufsaugen.“
„Subsidiarität“ staatlicher Tätigkeit heißt also nicht, Aufgaben zu übernehmen, die angeblich die übergeordnete Instanz „effizienter“ wahrzunehmen vermag, sondern die untergeordneten Sozialgebilde in der Wahrnehmung ihrer je eigenen Aufgabe zu unterstützen. Das erste und grundlegende Gebot der subsidiären Staatstätigkeit ist der Schutz des Privateigentums und von allem, was damit in irgendeiner Weise verbunden ist. Dies ist nicht die einzige Aufgabe des Staates, aber die grundlegende und für das Gemeinwohl wichtigste. Wen das erstaunt, der sollte unbedingt weiterlesen.
„Soziale Marktwirtschaft“?
„Subsidiarität“ staatlichen Handelns heißt in erster Linie: Achtung und Schutz des Privateigentums und damit Ermöglichung von Freiheit, Förderung der Selbstverantwortung, Begünstigung der Familie nicht durch Zulagen aller Art, sondern durch niedrige Steuern, und Ermöglichung unternehmerischer Kreativität, die zu Wohlstand führt, durch den Verzicht auf staatliche Privilegierungen einzelner Wirtschaftsbereiche mit Subventionen oder der gesetzlichen Errichtung von Marktschranken und staatlichen Monopolbetrieben. Doch tut der moderne überschuldete Sozialstaat genau das Gegenteil.
Durch exorbitante Steuerbelastung, Umverteilung und bürokratisch-regulatorische Behinderung der unternehmerischen Freiheit auf allen Ebenen, gerade auch der Kleinstunternehmer, werden die Rechte der Eigentümer massiv missachtet. Der Staat verzerrt den Markt durch Regulierungen, Subventionen und gesetzliche Markteintrittsschranken (auf dem Arbeitsmarkt auch durch Mindestlöhne), sowie tarifäre und nichttarifäre Handelsbeschränkungen, die vor allem den ärmsten Ländern schaden. Im gleichen Zug haben sich der Staat und seine Bürokratien, die selbst ein Interesse an ihrem stetigen Wachstum haben, immer neuer Aufgaben angenommen.
Das alles geschah oft unter dem Feigenblatt „soziale Marktwirtschaft“, ein Begriff, dessen ursprünglicher Sinn längst pervertiert worden ist – allerdings nicht ohne Schuld einiger ihrer Gründerväter wie Alfred Müller-Armack, die die Öffnung der Pandorabüchse des „sozialen Ausgleichs“ durch Steuern und Umverteilung theoretisch rechtfertigten. „Sozial“ war die soziale Marktwirtschaft jedoch für ihren politischen Hauptgestalter, Ludwig Erhard, insofern sie auf freiem Wettbewerb beruht und dadurch, so Erhard, dem Konsumenten und nicht dem Produzenten dient und damit „Wohlstand für alle“ und nicht nur für einige zu schaffen vermag. Sozialen Ausgleich durch Umverteilung lehnte Erhard ab. Denn er war überzeugt, dass das Soziale der sozialen Marktwirtschaft gerade der Markt ist – so er denn in seinem „Markt-Sein“ nicht behindert wird.
Diesen Wohlstand für alle, den die wettbewerbsorientierte Marktwirtschaft ja tatsächlich geschaffen hat, wird nun, paradoxerweise gerade weil dieser Wohlstand zur Norm geworden ist, unter dem Schlagwort „soziale Gerechtigkeit“ durch eine grassierende Neidkultur nach und nach unterminiert. „Wohlstand für alle“ erwartet man nicht von unternehmerischen Leistungen und ihren Wertschöpfungen, die ihre Wurzel oft gerade in gesunden Familienstrukturen haben, sondern von staatlicher Umverteilung. Doch diese schafft keinen Mehrwert und keinen Wohlstand. Während der „Kapitalist“ Reichtum spart, weil er ihn investiert, konsumiert der Staat einen beträchtlichen Teil des Reichtums, den er seinen Bürgern zuvor aus der Tasche gezogen hat. Das ist, wie wir heute wissen, extrem ineffizient und kann zur Lähmung und kollektiven Verarmung fortgeschrittener Industriegesellschaften führen. Beste Beispiele heute: Griechenland und zunehmend auch Frankreich, früher einmal England vor Margaret Thatcher.
Mangelnde Subsidiarität und der Missbrauch des staatlichen Geldmonopols
Wenige sind sich bewusst, dass das staatlich kontrollierte Geldsystem – ein Staatsmonopol –, dessen Missbrauch dies ja alles erst möglich macht, wie auch der oft angeprangerte „Finanzkapitalismus“ selbst gar nicht marktwirtschaftlich oder „kapitalistisch“ sind. Im echten Kapitalismus, in dem Reichtum in die Produktion von Sachwerten, also in die „Realwirtschaft“, investiert wird und dem Finanzsektor eine entsprechend dienende Funktion zukommt, gewinnen alle. Beim gegenwärtigen Kasino-Spiel unter dem Schutzschirm des staatlichem Geldmonopols gewinnen die Vermögenden auf Kosten der Nichtvermögenden, insbesondere der kleinen Sparer und zunehmend des Mittelstandes; denn die Vermögenden sind es, die am meisten von der ständig laufenden Notenpresse profitieren und in Aktien und Immobilien investieren können.
Im echten Kapitalismus werden neue Werte generiert, die in der Form von höheren Reallöhnen allen zugutekommen. Im staatmonopolistischen Geldsystem hingegen, das den Politikern ermöglicht, ihre stets neuen Versprechen zu finanzieren, wird vor allem Geld produziert, auf Knopfdruck und aus dem Nichts. Das treibt die Aktien- und Immobilienpreise künstlich in die Höhe, vermehrt den Schein-Reichtum einiger weniger, aber immer wieder anderer Superreicher und vermag unverantwortlich agierende Banken zu retten. Gleichzeitig unterminiert diese Politik aber echt unternehmerischen Geist, erhält ineffiziente Strukturen und enteignet durch niedrige bis de facto negative Zinsen – und irgendwann einmal durch steigende Inflation – die kleinen Sparer, ganz besonders natürlich die mittelständische Familie.
Das alles sind Auswirkungen mangelnder, ja heute weitgehend fehlender „Subsidiarität“ des Staates; sie sind das pure Gegenteil von Kapitalismus und freier Marktwirtschaft. Dieser Mangel setzt falsche Anreize, treibt den Bürger nicht nur in die Abhängigkeit vom Staat, sondern auch in die Lethargie und in ein trügerisches Vertrauen in eine Politik, die beständig von ihrer eigenen „Alternativlosigkeit“ spricht. Die Schuld wird zunehmend gerade in dem gesehen, was noch die Reste unseres Wohlstands zu garantieren vermag: Marktwirtschaft und „Kapitalismus“, letztlich also das Unternehmertum. Sie werden zunehmend an den Pranger gestellt, ja verteufelt. Die Politik, der Staat soll es richten. Vertrauen in die spontanen und schöpferischen Kräfte der menschlichen Freiheit und Eigenverantwortung fehlt weitgehend. Der Bürger fühlt sich ohnmächtig und nicht mitverantwortlich, obwohl er ja die Politiker wählt – oder wählen sollte.
Eine Reise in die Geschichte der katholischen Soziallehre
Man könnte einwenden, dies sei eine Überzeichnung der Situation und zudem habe es nichts mit dem eigentlichen Sinn des Subsidiaritätsprinzips der katholischen Soziallehre zu tun. Denn nach diesem müsse doch gerade der Staat dann einspringen, wenn die „untere Ebene“ es nicht mehr alleine schafft. Das Prinzip sei deshalb in keiner Weise staatskritisch gemeint. Greifen wir jedoch zu den Quellen, werden wir eines besseren belehrt. So beklagte im Jahre 1932 einer der Hauptverfasser der Enzyklika Pius‘ XI und Hauptvertreter der Katholischen Soziallehre, Oswald von Nell-Breuning SJ – in einem Kommentar zum Abschnitt über das Subsidiaritätsprinzip ebendieser Enzyklika – einen falschen „atomistisch-individualistischen Geist“, der die „natürlich gewachsenen kleineren Lebensgemeinschaften“, insbesondere die Familie, zerstört und das Individuum in die Arme des Staates treibt. „Der Staat reißt immer mehr an sich, er wird auch immer mehr von allen Seiten zu Hilfe gerufen und in Anspruch genommen. So wächst der Umfang der Staatstätigkeit in der Tat unaufhaltsam. Ein Blick auf die Haushaltszahlen aller neuzeitlichen Staaten bestätigt es; in allen Ländern der Welt sehen wir den Staathaushalt von Jahr zu Jahr sich weiter aufblähen, bis wir jüngst in Deutschland an die Grenzen gestoßen sind, wo es einfach nicht mehr weiter geht und wo eine gewaltsame Zurückschraubung sich als unerbittliche Notwendigkeit aufzwingt.“
Das war 1932! Gemäß Vito Tanzi und Ludger Schuknecht („Public Spending in the 20th Century“, 2000) beliefen sich die Staatseinnahmen Deutschlands 1920 auf 8,6 % und 1937 auf 15,9 % des BIP; nach 1997 hingegen waren es 45 % (Schweden 61,1), 2012 (laut Eurostat) 44 %; der EU Durchschnitt lag im gleichen Jahr bei 49 % des BIP. Sozialtransfers (Sozialleistungen und soziale Sachleistungen) entsprachen 43,3 % der Gesamteinnahmen in den 28 EU Ländern und 46,5 % im Euroraum. Das sind erstaunliche Zahlen. Pius XI. und sein zeitgenössischer Kommentator würden sich heute die Haare raufen.
Wir können aber noch weiter zurückgehen, zum „Stammvater“ der modernen katholischen Soziallehre, dem Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel Freiherr von Ketteler. Er prangerte 1864 in seiner Schrift „Die Arbeiterfrage und das Christentum“ als die große Gefahr „das Project der durch Majoritäten decretierten Staatshilfe“ an. Gegenüber diesem sich verbreitenden Übel sei gerade für „sociale Zwecke“ die „individuelle Freiheit“ zu verteidigen. Die Gefahr sei „ein immer weiter ausgebildetes Steuer- und Zwangssystem, an dem sämtliche Staaten fast zu Grunde gehen und bei denen freie Selbstbestimmung und Gesinnung gänzlich in den Hintergrund treten (…). Wir sehen hier, wie diese Idee des Steuer- und Zwangssystems immer weiter geht und dadurch die moderne Richtung bekundet, dass ihr alle Prinzipien der wahren Freiheit fehlen.“ Ketteler war es auch, der die Staatstätigkeit zum ersten Mal als notwendigerweise „subsidiär“ bezeichnete. Er bezog das auf das Schulwesen. Staatlichen Schulzwang und gewisse gesetzliche Grundanforderungen befürwortete er, ebenso aber „Lehr- und Lernfreiheit“. Staatschule mit vorgeschriebenen Lehrinhalten sei „Staatmonopol“, welche aus der Schule „eine offizielle Corruptionsanstalt des Volkes“ mache.
Das also ist Ursprung des Subsidiaritätsprinzips innerhalb der katholischen Soziallehre, genau gesehen eine für die heutige Zeit aufrüttelnde Verteidigung der individuellen Freiheit und der sozialen Verantwortung des Individuums und der Familie. Es weist auf eine echte Alternative hin. Pius XI. nannte es, wie gesagt, einen „höchst gewichtigen sozialphilosophischen Grundsatz“. Seine Anwendung wurde allerdings von Vertretern der katholischen Soziallehre immer wieder auf ganz verschiedene Weise verstanden und dabei nicht selten umgedeutet und verfälscht. Heute dient es zumeist, seiner ursprünglichen Intention entgegen, als argumentativer Hebel, um staatliche Sozialpolitik und die stete Ausweitung der Sozialbürokratie zu rechtfertigen (aktuelles Stichwort: „Betreuungsgeld“).
Doch auf die Tradition der katholischen Soziallehre kann man sich dabei nicht wirklich berufen. Wer es tut, vergisst, dass die erste Sozialenzyklika der katholischen Kirche, „Rerum novarum“ von Papst Leo XIII. (1891) vor allem das Privateigentum verteidigte. Das Subsidiaritätsprinzip verlangt heute nicht staatliche Subventionen, sondern geringere Steuerbelastung. Schutz und Respektierung des Privateigentums, die durch exorbitante Steuern und Sozialabgaben missachtet werden, ist auch die Grundlage und die Messlatte für die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. So schrieb Leo XIII., die „öffentliche Autorität“ müsse „durch entschiedene Maßregeln das Recht und die Sicherheit des privaten Besitzes gewährleisten (…). Die Bewegung der Masse, wenn ihre Gier nach fremder Habe erwacht, muss mit Kraft gezügelt werden. Ein Streben nach Verbesserung der eigenen Lage ohne ungerechte Schädigung anderer tadelt niemand, aber auf Aneignung fremden Besitzes ausgehen, und dies unter dem törichten Vorgeben, es müsse eine Gleichmacherei in der Gesellschaft erfolgen, das ist ein Angriff auf die Gerechtigkeit und das Gemeinwohl zugleich.“
Als rückständig galt lange, wer solches zitierte. Aber heute erweisen sich diese Worte als prophetisch. Papst Johannes Paul II. hatte 1991, zum hundertsten Jahrestag von „Rerum novarum“ die naive Sozialstaatseuphorie der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg relativiert. In seiner Enzyklika „Centesimus annus“ heißt es über den umverteilenden Sozialstaat: „Der Wohlfahrtsstaat, der direkt eingreift und die Gesellschaft ihrer Verantwortung beraubt, löst den Verlust an menschlicher Energie und das Aufblähen der Staatsapparate aus, die mehr von bürokratischer Logik als von dem Bemühen beherrscht werden, den Empfängern zu dienen. Hand in Hand damit geht eine ungeheure Ausgabensteigerung.“
Das war vor bald fünfundzwanzig Jahren. Heute druckt der Staat fleißig Geld, um das System der öffentlichen Überschuldung und staatlichen sozialen Absicherung über Wasser zu halten. Politiker täten besser daran, sich an die alte Weisheit des Subsidiaritätsprinzips zu erinnern. Dieses negiert nicht die Aufgabe des Staates, sieht diese aber darin, den untergeordneten Sozialkörpern und der Zivilgesellschaft zu ermöglichen, die ihnen eigene Aufgabe wahrzunehmen. Christian Hermann Vosen, Priester und Freund des Gesellenvaters Adolph Kolping, trat im Sinne der Subsidiarität im Jahre 1864 für eine „die Freiheit nicht gefährdende Unterstützung unserer Selbsthilfe durch den Staat“ ein. Er war aber gegen Staatshilfe durch Umverteilung, wie sie die deutschen Sozialisten unter der Führung von Ferdinand Lassalle forderten. „Staatshilfe ist Vormundschaft und wird für den einzelnen zuletzt Sklaverei, mag auch der Staat Republik heißen und das Blut vieler Tausender von Arbeitern gekostet haben, die im Durchsetzen solch einer Republik das Heil des Arbeiterstandes zu erkämpfen wähnen.“
Das Subsidiaritätsprinzip neu entdecken
Umverteilende Sozialpolitik ist ökonomisch ineffizient und sie ist unsozial, sie schafft neue Armut und Abhängigkeiten und kann in die Entwürdigung führen. Und zusammen mit anderen Staatseingriffen in das Gefüge der Gesellschaft – das Gefüge der Interaktion freier Individuen – hemmt sie das echte Wachstum, das allein Wohlstand für alle schaffen kann. Bürger sollten aufgeklärt werden, damit sie nicht weiterhin Politiker wählen, die sich durch „soziale“ Wahlversprechungen populär machen, damit aber das Übel vergrößern. Ich persönlich bin überzeugt: Würde das Subsidiaritätsprinzip ernstgenommen, hätten wir eine bessere und menschlichere Gesellschaft und einen Wohlstand, der nicht schleichend unser materielles und soziales Kapital und vor allem dasjenige der kommenden Generationen zerstört.
Im Lichte der Erfahrungen der letzten Jahrzehnte und der gegenwärtigen chronischen Finanz- und Wirtschaftskrise bedarf es einer Neuentdeckung des Subsidiaritätsprinzips. Auch für Vertreter der kirchlichen Soziallehre besteht hier meiner Meinung nach Nachholbedarf – und zwar gerade im Interesse der Ärmsten. Neu zu entdecken und zu reflektieren ist hier insbesondere der Zusammenhang des Subsidiaritätsprinzips mit der zentralen Rolle des Privateigentums, der Familie und des freien Unternehmertums. Sie sind es, die das Gemeinwohl generieren und die Grundlagen einer wirklich humanen und sozialen Gesellschaft bilden, die des Staates eben nur subsidiär bedarf – nicht als Schöpfer einer angeblichen „sozialen Gerechtigkeit“, welche Staat und Politik nie und nimmer herzustellen vermögen, sondern zuallererst einmal als Garant jener Rechte, die das menschliche Individuum und die Familie von Natur aus besitzen.
Dieser Artikel wurde ursprünglich in zwei Teilen (am 29. April und 6. Mai 2015) in der ‚Klartextfabrik‘ des Deutschen Arbeitgeberverbandes publiziert.